Was ist Völlerei? Eine kurze Einführung in das Konzept der übermäßigen Nahrungsaufnahme und deren Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden. Erfahren Sie mehr über die Gründe für Völlerei, wie sie sich manifestiert und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um einen ausgewogenen Lebensstil zu fördern.
- Kirschsaft selber machen – ein fruchtiger Genuss!
- Warum Herbal Essences nicht mehr erhältlich ist: Hintergründe und Auswirkungen
- Schnelle und leckere Brötchen selbst backen mit Trockenhefe
- Der aktuelle Silberkurs und die Preise für eine Unze Silber
- Maschenmarkierer selber machen: Anleitung für schöne Markierer
1. Die Bedeutung von Völlerei: Ursprung, Definition und Konsequenzen
Die Völlerei wird als unmäßiges Essen definiert und von der katholischen Kirche als eine der sieben Todsünden betrachtet. Theologen und Moralisten des Mittelalters verurteilten die Völlerei und predigten stattdessen Mäßigung. Im Mittelalter war es nur bei geregelten gemeinsamen Mahlzeiten erlaubt, Freude am Essen zu haben. In der frühen Neuzeit wurde das Bild des „Fresssacks“ durch das des Feinschmeckers oder Genießers ersetzt.
Heute richtet sich die moralische Kritik eher an den Schlankheitskult und das Gesundheitsbewusstsein. Die Völlerei zieht weitere Sünden nach sich, aber Absicht und Kontext entscheiden darüber, ob sie schwerwiegend oder verzeihlich ist. Magenfreuden werden mit den Freuden des Unterleibs in Verbindung gebracht und somit mit der Sünde der Wollust, die zu sinnlichen Ausschweifungen führen kann.
Die christliche Moral verdammt diejenigen, die ihren Bauch zum Gott machen und gierig und maßlos essen. Sie erniedrigt sie zu Tieren und verleitet sie dazu, das Prinzip der christlichen Nächstenliebe zu verspotten sowie sich dem Verdacht unzüchtiger Sexualität auszusetzen. In der Literatur des Mittelalters wurden gefräßige Mönche verspottet, während der französische König Ludwig XVI. als verantwortlich für den Volkshunger galt.
Auch die Freude am und das Streben nach gutem Essen wurden von der Völlerei verurteilt. Die Reformatoren griffen die Völlerei der Geistlichen an, die an Fastentagen raffinierte Fischgerichte und Leckereien zubereiteten. Das Christentum schwankt zwischen Toleranz und Strenge, wodurch die Frage nach Gaumenfreuden jahrhundertelang diskutiert wurde.
Die Antwort auf die Sünde der Völlerei liegt in der Mäßigung, einer der vier Kardinaltugenden, die von Theologen, Moralisten und Pädagogen jahrhundertelang gepredigt wurde. Auch die ältere Ernährungslehre empfahl Ausgewogenheit und Maßhalten. Wenn Essensfreude akzeptiert wird, müssen gleichzeitig Appetit und Tischsitten gezügelt werden, damit die Mahlzeit zu einem gemeinsamen Akt wird. So entwickelte sich im Laufe der Zeit eine Esskultur, die der Völlerei einen akzeptablen Rahmen setzte.
Ab dem 17. Jahrhundert befreiten Einsicht und Wissenschaft die Völlerei von ihrem negativen Image. Es wurden Kochbücher veröffentlicht und die Wertschätzung für gutes Essen entwickelte sich in Frankreich und Europa als Zeichen gesellschaftlicher Unterscheidung. Die aristokratische Gesellschaft des 17. und 18. Jahrhunderts schwelgte in kulinarischen Ausschweifungen, bei denen gastronomische Raffinesse mit anderen sinnlichen Freuden verbunden wurde.
Die negativ konnotierte Völlerei nahm zu dieser Zeit eine andere Maske an und wurde als Schlemmerei, dann als Feinschmeckertum und im 19. Jahrhundert auch als Genuss bezeichnet. In dieser Zeit bezog sich die Völlerei vor allem auf süße Speisen.
Heute wird die Völlerei wieder moralisch neu bewertet. Der Schlankheitskult und der medizinische Diskurs machen sie erneut zu einem Vergehen. Wer sich an Ernährungsvorschriften hält, empfindet Essen oft als zwanghaft oder frustrierend. „Der Völlerei nachzugeben“ wird zur Schuld erklärt und offenbart angeblich eine Schwäche des Charakters gegenüber sich selbst und der Gesellschaft, da Krankheiten Sozialkosten verursachen können.
In den Filmen „La Grande Bouffe“ (1973) (Das große Fressen) und „Babettes gæstebud“ (1987) (Babettes Fest) geht es um ein Feinschmeckermahl. In „Babettes Fest“ wird das Mahl zu einem Fest der sozialen Gemeinschaft, bei dem die sonst enthaltsam lebenden Personen zu Feinschmeckern werden. Die Protagonisten in „Das große Fressen“ verkörpern dagegen die Völlerei als maßloses Vergnügen für Bauch und Unterleib, bei dem kulinarischer Genuss mit fleischlicher Lust verbunden wird, um schließlich Gewalt gegen sich selbst anzutun – eine Sünde, die Dante Alighieris Göttliche Komödie dem siebten Kreis der Hölle zuweist.
2. Völlerei als Todsünde: Die moralische Bewertung von übermäßigem Essen

Die katholische Kirche betrachtet Völlerei als eine der sieben Todsünden, genannt Gula. Theologen und Moralisten des Mittelalters verurteilten diese Sünde und predigten Mäßigung. Freude am Essen war nur bei geregelten gemeinsamen Mahlzeiten erlaubt.
In der frühen Neuzeit wurde das Bild des „Fresssacks“ durch das des Feinschmeckers oder Genießers ersetzt. Heutzutage richtet sich die Moral eher an den Schlankheitskult und das Gesundheitsbewusstsein.
Völlerei ist eine Todsünde, die weitere Sünden nach sich zieht. Allerdings hängt es von Absicht und Kontext ab, ob sie schwerwiegend oder verzeihlich ist. Magenfreuden können auf sinnliche Lust hinweisen, die zur Sünde der Wollust führt. Daher verurteilt die christliche Moral jene, die gierig und maßlos essen und ihren Bauch zu ihrem Gott machen.
Die Darstellung des Fresssacks zeigt einen Egoisten, der alles verschlingt und in Hungersnöten zur gesellschaftlichen Bedrohung wird. Die Literatur des Mittelalters machte sich über gefräßige Mönche lustig, während der französische König Ludwig XVI. als verantwortlich für den Volkshunger angesehen wurde.
Die Antwort auf die Sünde der Völlerei liegt in der Mäßigung, einer der vier Kardinaltugenden, die von Theologen, Moralisten und Pädagogen jahrhundertelang gepredigt wurde. Auch die ältere Ernährungslehre empfahl Ausgewogenheit und Maßhalten.
Einsicht und Wissenschaft haben die Völlerei ab dem 17. Jahrhundert vom negativen Image befreit. Es wurden Kochbücher veröffentlicht und die Wertschätzung für gutes Essen entwickelte sich zur gesellschaftlichen Differenzierung.
Heutzutage wird Völlerei wieder moralisch neu bewertet, aufgrund des Schlankheitskults und des medizinischen Diskurses. Wer sich an Ernährungsvorschriften hält, empfindet Essen oft als zwanghaft oder frustrierend.
Die Filme „La Grande Bouffe“ (Das große Fressen) und „Babettes gæstebud“ (Babettes Fest) handeln von einem Feinschmeckermahl. In „Babettes Fest“ wird das Mahl zum Fest sozialer Gemeinsamkeit, während in „Das große Fressen“ Völlerei als massloses Vergnügen dargestellt wird.
Die negative Konnotation der Völlerei hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Von „Fresssäcken“ nannten sich Schlemmer dann Feinschmecker und später Genießer. Im 19. Jahrhundert bezog sich Völlerei vor allem auf süße Speisen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die moralische Bewertung von übermäßigem Essen unterschiedlich ist, je nach historischem Kontext und gesellschaftlichen Normen. Die Todsünde der Völlerei wurde von der katholischen Kirche verurteilt, aber die Vorstellungen und Bewertungen haben sich im Laufe der Zeit gewandelt. Heutzutage wird Völlerei oft mit negativen Konsequenzen für die Gesundheit und Gesellschaft assoziiert.
3. Vom Fresssack zum Feinschmecker: Der Wandel des Bildes der Völlerei im Laufe der Zeit
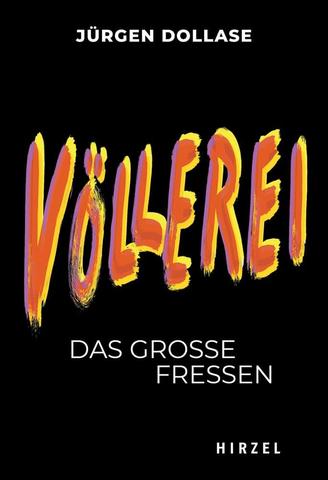
Die Darstellung der Völlerei als unmäßiges Essen wurde von der katholischen Kirche im Mittelalter als Todsünde verurteilt. Theologen und Moralisten predigten stattdessen Mäßigung und erlaubten die Freude am Essen nur bei geregelten gemeinsamen Mahlzeiten. In der frühen Neuzeit wurde das Bild des „Fresssacks“ durch das des Feinschmeckers oder Genießers ersetzt.
Heutzutage richtet sich die Moral eher an den Schlankheitskult und das Gesundheitsbewusstsein. Die Völlerei wird weiterhin als Todsünde betrachtet, die zu weiteren Sünden führen kann. Allerdings hängt es von Absicht und Kontext ab, ob sie als schwerwiegend oder verzeihlich angesehen wird.
Die christliche Moral verurteilt diejenigen, die gierig und maßlos essen und ihren Bauch zu ihrem Gott machen. Diese Gefräßigkeit erniedrigt sie zu Tieren und verleitet sie dazu, das Prinzip der christlichen Nächstenliebe und des Teilens zu verspotten. Gleichzeitig setzen sie sich dem Verdacht einer verwerflichen Sexualität aus.
In der Literatur des Mittelalters wurden gefräßige Mönche verspottet, während der französische König Ludwig XVI., der als verantwortlich für den Volkshunger galt, als verfressen bezeichnet wurde. Selbst die Freude am guten Essen wurde damals vom Sündenverdikt betroffen. Die Reformatoren kritisierten die Völlerei der Geistlichen, die an Fastentagen raffinierte Fischgerichte und Leckereien zubereiteten.
Die Antwort auf die Sünde der Völlerei liegt in der Mäßigung, einer der vier Kardinaltugenden, die von Theologen, Moralisten und Pädagogen jahrhundertelang gepredigt wurde. Auch die ältere Ernährungslehre empfahl Ausgewogenheit und Maßhalten. Wenn Essensfreude akzeptiert ist, müssen im Gegenzug Appetit und Tischsitten gezügelt und die Mahlzeit als gemeinsamer Akt gestaltet werden. So entwickelte sich die Esskultur und setzte der Völlerei einen akzeptablen Rahmen.
Ab dem 17. Jahrhundert befreiten Einsicht und Wissenschaft die Völlerei von ihrem negativen Image. Es wurden Kochbücher veröffentlicht und die Wertschätzung für gutes Essen entwickelte sich in Frankreich und später in ganz Europa als Zeichen gesellschaftlicher Differenzierung. Die aristokratische Gesellschaft schwelgte im 17. und 18. Jahrhundert in Ausschweifungen, bei denen gastronomische Raffinesse mit anderen Sinnesfreuden verbunden wurden.
Die negativ konnotierte Völlerei nahm zu dieser Zeit eine andere Maske an: Schlemmer nannten sich Feinschmecker oder Genießer im 19. Jahrhundert. In dieser Zeit bezog sich Völlerei vor allem auf süße Speisen.
Heutzutage wird die Völlerei wieder moralisch neu bewertet. Der Schlankheitskult und der medizinische Diskurs machen sie erneut zu einem Vergehen. Wer sich an Ernährungsvorschriften hält, empfindet Essen möglicherweise als zwanghaft oder frustrierend. „Der Völlerei nachzugeben“ wird zur Schuld erklärt und offenbart Charakterschwäche gegenüber sich selbst und der Gesellschaft, da Krankheiten Sozialkosten verursachen können.
In den Filmen „Das große Fressen“ (1973) und „Babettes Fest“ (1987) spielt ein Feinschmeckermahl eine zentrale Rolle. In „Babettes Fest“ wird es zum Fest sozialer Gemeinsamkeit, bei dem die enthaltsam lebenden Akteure zu Feinschmeckern werden. Die Protagonisten in „Das große Fressen“ verkörpern dagegen die Völlerei als massloses Vergnügen für Bauch und Unterleib, das kulinarische und fleischliche Lust vereint und schließlich zu Selbstschädigung führt – eine Sünde, die Dante Alighieris Göttliche Komödie dem siebten Kreis der Hölle zuweist.
Quellen:
– Clément, Marie-Christine, Gourmandise, in sous la direction de Poulain, Jean-Pierre, Dictionnaires des cultures alimentaires, Paris : PUF, 2012
– Fischler, Claude. 2001. L’Homnivore. Paris : Odile Jacob.
– Fischler, Claude, Gourmandise, histoire d’un péché mignon, 08.07. 2008 https://www.scienceshumaines.com/gourmandise-histoire-d-un-peche-mignon_fr_22467…, consulté le 20 février 2017
– Flandrin, Jeano-Louis, Les temps modernes, in sous la direction de Flandrin, Jean-Louis, Montanari, Massimo, Histoire de l’alimentation, Paris : Fayard, 1996
– Quellier, Florent. 2010. Gourmandise histoire d’un péché capital. Paris : Armand Colin.
4. Die Rolle der Mäßigung bei der Bekämpfung von Völlerei

Die Mäßigung spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Völlerei. Sie war schon immer eine der vier Kardinaltugenden und wurde jahrhundertelang von Theologen, Moralisten und Pädagogen gepredigt. Die Idee dahinter ist, dass man sich beim Essen zurückhalten sollte und nicht maßlos und gierig sein darf.
Die Mäßigung beinhaltet auch die Ausgewogenheit in der Ernährung. Es geht darum, nicht nur auf den Geschmack zu achten, sondern auch auf die Nährstoffe und die Gesundheit. Eine ausgewogene Ernährung bedeutet, dass man alle wichtigen Nährstoffe in angemessenen Mengen zu sich nimmt und nicht übermäßig viel isst.
Um Völlerei zu bekämpfen, muss man seinen Appetit zügeln können. Man sollte lernen, seine Essensportionen zu kontrollieren und bewusst zu essen. Es geht darum, das Essen als einen gemeinsamen Akt zu betrachten und es mit anderen Menschen zu genießen.
Die Mäßigung ist auch wichtig, um den Schlankheitskult und das Gesundheitsbewusstsein anzugehen. Oftmals führt der Druck zur schlanken Figur dazu, dass Menschen zwanghaft oder frustriert essen. Dies kann zu einer ungesunden Beziehung zum Essen führen und letztendlich zur Völlerei führen.
Insgesamt spielt die Mäßigung eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Völlerei. Sie hilft dabei, den Appetit zu kontrollieren, eine ausgewogene Ernährung zu erreichen und das Essen bewusst zu genießen. Durch die Mäßigung kann man sich von der negativen Konnotation der Völlerei befreien und eine gesunde Beziehung zum Essen entwickeln.
5. Völlerei heute: Zwischen Schlankheitskult und Gesundheitsbewusstsein

Die heutige Vorstellung von Völlerei ist geprägt von einem Spannungsfeld zwischen dem Schlankheitskult und dem zunehmenden Gesundheitsbewusstsein. In unserer Gesellschaft wird oft ein schlanker Körper als erstrebenswert angesehen, während übermäßiges Essen als moralisches Vergehen betrachtet wird.
Der Schlankheitskult hat dazu geführt, dass viele Menschen eine zwanghafte Beziehung zum Essen entwickeln. Sie halten sich strikt an Ernährungsvorschriften und empfinden Essen oft als frustrierend oder gar schuldhaft. Die Kontrolle über die Nahrungsaufnahme wird zur Charakterschwäche gegenüber sich selbst und der Gesellschaft stilisiert, da Krankheiten Sozialkosten verursachen können.
Gleichzeitig hat das wachsende Gesundheitsbewusstsein dazu geführt, dass Menschen bewusster auf ihre Ernährung achten. Es geht nicht mehr nur darum, satt zu werden, sondern auch um die Qualität der Nahrungsmittel und deren Auswirkungen auf den Körper. Eine ausgewogene Ernährung mit gesunden Lebensmitteln steht im Fokus vieler Menschen.
Insgesamt hat sich die Wahrnehmung von Völlerei im Laufe der Zeit gewandelt. Während sie früher als Todsünde galt und stark verurteilt wurde, wurde sie später durch den Begriff des Feinschmeckers oder Genießers ersetzt. Heutzutage stehen jedoch vor allem der Schlankheitskult und das Gesundheitsbewusstsein im Vordergrund, wodurch Völlerei erneut negativ bewertet wird.
6. Völlerei in Film und Literatur: Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema

Die Darstellung der Völlerei hat in Film und Literatur eine lange Tradition. Dabei wird das Thema oft kritisch betrachtet und hinterfragt. Ein Beispiel dafür ist der Film „La Grande Bouffe“ (Das große Fressen) aus dem Jahr 1973. In diesem Film geht es um vier Männer, die sich zu einem exzessiven Essensgelage treffen und dabei immer weiter über ihre Grenzen hinausgehen. Die Protagonisten verkörpern die Völlerei als massloses Vergnügen, das letztendlich zu Selbstzerstörung führt.
Ein weiteres Beispiel ist der Film „Babettes Fest“ aus dem Jahr 1987. Hier steht zwar ebenfalls das Essen im Mittelpunkt, jedoch wird die Völlerei in einem anderen Kontext betrachtet. Das Festmahl, das von der Hauptfigur Babette zubereitet wird, dient nicht nur als kulinarisches Erlebnis, sondern auch als Symbol für soziale Gemeinsamkeit und Veränderung. Die zurückhaltenden und enthaltsamen Charaktere entwickeln sich durch das Essen zu Feinschmeckern und öffnen sich für neue Erfahrungen.
In der Literatur findet man ebenfalls zahlreiche Werke, die sich mit dem Thema Völlerei auseinandersetzen. Ein bekanntes Beispiel ist Dante Alighieris „Göttliche Komödie“, in der die Völlerei als eine Sünde dargestellt wird, die den Menschen in den siebten Kreis der Hölle führt. Diese Darstellung verdeutlicht die moralische Verwerflichkeit der Völlerei und ihre negativen Auswirkungen auf die Seele.
Die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Völlerei in Film und Literatur zeigt, dass es sich um ein vielschichtiges und kontroverses Thema handelt. Es wird deutlich, dass die Völlerei nicht nur als Genuss, sondern auch als moralisches Vergehen betrachtet werden kann. Durch die Darstellung in verschiedenen Medien wird das Bewusstsein für die Konsequenzen der Völlerei geschärft und zum Nachdenken angeregt.
Zusammenfassend kann Völlerei als ein übermäßiges und unkontrolliertes Essen definiert werden, das negative Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden haben kann. Es ist wichtig, ein ausgewogenes Essverhalten zu pflegen und bewusst auf Signale des Körpers zu achten, um eine gesunde Beziehung zum Essen zu entwickeln.

